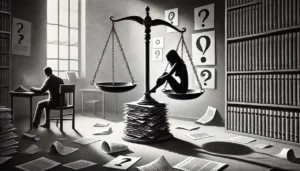Einleitung
Die Studie untersucht die Erfahrungen von trans und nicht-binären Sexarbeiter*innen in Kanada mit dem Rechtssystem, insbesondere mit Blick auf Zugänge zur Justiz und Erfahrungen mit Gewalt und Polizeikontakt. Dies geschieht vor dem Hintergrund des kanadischen Gesetzes „Protection of Communities and Exploited Persons Act“ (PCEPA) von 2014, das ein sogenanntes „Endnachfrage“-Modell verfolgt, bei dem der Kauf sexueller Dienstleistungen kriminalisiert wird, nicht jedoch der Verkauf.
Die Studie betont die Notwendigkeit eines intersektionalen Ansatzes, da trans und nicht-binäre Menschen – insbesondere diejenigen, die sexuelle Diensleistungen anbieten – mehreren Formen von Diskriminierung ausgesetzt sind, etwa aufgrund von Geschlechtsidentität, Rassismus und sozioökonomischen Benachteiligungen.
Methodik
Die Daten stammen aus der nationalen Studie „Trans PULSE Canada“ von 2019, bei der über 2000 trans und nicht-binäre Personen befragt wurden. Die Studie nutzte verschiedene Erhebungsmethoden (online, telefonisch, Papierform) und fokussierte auf neun „Prioritätsgruppen“, darunter Sexarbeiter*innen. Von den 2012 einbezogenen Teilnehmenden hatten 280 (16,1 %) jemals Sexarbeit geleistet. Die Datenanalyse erfolgte anhand intersektionaler Merkmale wie Geschlecht bei Geburt, ethnorassischer Zugehörigkeit und Haushaltseinkommen.
Rechtlicher und gesellschaftlicher Kontext
Seit der Einführung von PCEPA verfolgt Kanada ein Modell, das Sexarbeit als grundsätzlich schädlich darstellt. Zwar soll es den Schutz von Sexarbeiterinnen verbessern, faktisch kriminalisiert es jedoch zentrale Aspekte ihrer Arbeit, wie etwa Werbung, das Einziehen von Einnahmen durch Dritte und Kommunikation an öffentlichen Orten. Dies erschwert den Zugang zu Schutz- und Unterstützungsdiensten erheblich. Frühere Studien belegen, dass viele Sexarbeiterinnen aus Angst vor Kriminalisierung keine Notrufe absetzen oder Gewalt nicht melden.
Zentrale Ergebnisse
Gewalt- und Polizeierfahrungen
Trans und nicht-binäre Sexarbeiter*innen berichteten signifikant häufiger von Gewalt und negativer Polizeierfahrung als andere trans und nicht-binäre Personen:
Polizeihandlungen: 72,1 % der Sexarbeiterinnen erwarteten Polizeischikane, 43,2 % berichteten von tatsächlichem polizeilichem Fehlverhalten (im Vergleich zu 50,5 % bzw. 15,7 % bei Nicht-Sexarbeiterinnen).
Gewalt: 61,4 % der Sexarbeiter*innen erlebten physische oder sexuelle Gewalt in den letzten fünf Jahren (vs. 27,4 %), davon 41,4 % explizit wegen ihrer geschlechtlichen Identität.
911-Vermeidung: Über die Hälfte (51,4 %) der Sexarbeiter*innen vermied es, die Polizei zu rufen (vs. 18,1 %).
Vertrauen in das Justizsystem
Sexarbeiter*innen hatten nur geringes Vertrauen in eine faire Behandlung durch Polizei und Justiz:
Nur 10,8 % glaubten, bei körperlicher Gewalt fair behandelt zu werden.
Nur 4,7 % erwarteten faire Behandlung bei sexueller Gewalt.
Differenzierung nach Arbeitsform
Unter den Sexarbeiterinnen wiesen Straßenarbeiterinnen die höchsten Raten an Polizeischikane (70,6 %) und transfeindlicher Gewalt (53,9 %) auf. Personen, die ausschließlich remote arbeiteten (z. B. Online-Camming), berichteten deutlich seltener von direkter Gewalt, was auf den Schutz durch physische Distanz hinweist.
Intersektionale Unterschiede
Nach Geschlecht bei Geburt
Teilnehmende, die bei Geburt männlich zugeordnet wurden (AMAB), berichteten als Sexarbeiter*innen signifikant häufiger von transfeindlicher Gewalt als AFAB-Personen (57,1 % vs. 32,6 %).
Nach ethnorassischer Zugehörigkeit
Indigene und rassifizierte Sexarbeiter*innen waren besonders stark benachteiligt:
Polizeischikane erwartet: 95 % der indigenen und 87,9 % der rassifizierten Sexarbeiter*innen.
Kein Vertrauen in Justiz: Nur eine einzige von 76 indigenen oder rassifizierten Sexarbeiter*innen erwartete faire Behandlung bei sexueller Gewalt.
911-Vermeidung: 76,5 % der rassifizierten Sexarbeiter*innen mieden den Polizeinotruf.
Diese Muster zeigten sich auch unter nicht sexarbeitenden Personen dieser Gruppen, wenn auch weniger ausgeprägt.
Nach Einkommen
Auch Teilnehmerinnen aus Haushalten mit niedrigem Einkommen berichteten häufiger von Gewalt, Polizeischikane und vermieden häufiger den Notruf, insbesondere unter nicht sexarbeitenden Personen. Der Unterschied war bei Sexarbeiterinnen weniger deutlich, da sie insgesamt ohnehin höhere Belastungen aufwiesen.
Diskussion
Die Ergebnisse zeigen, dass PCEPA und das „Endnachfrage“-Modell ihre erklärten Ziele – Schutz der Sexarbeiterinnen und Förderung des Zugangs zur Justiz – verfehlen. Vielmehr haben sie die Lage für trans und nicht-binäre Sexarbeiterinnen verschärft, insbesondere für marginalisierte Gruppen wie transfeminine, indigene, rassifizierte oder straßenbasierte Personen.
Ein strukturelles Problem liegt in der Kriminalisierung der Arbeitsumgebung von Sexarbeiter*innen. Maßnahmen wie das Verbot der Werbung oder der Kommunikation in öffentlichen Räumen drängen viele in gefährlichere, isoliertere Kontexte. Das verstärkt das Risiko von Gewalt und reduziert die Chance auf Hilfe.
Zudem sind viele Betroffene nicht bereit oder in der Lage, die Polizei zu kontaktieren, sei es aus Angst vor Diskriminierung, Repression oder dem Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Dies führt zu einer chronischen Unterversorgung durch das Rechtssystem – trotz bestehender gesetzlicher Schutzbestimmungen gegen Diskriminierung.
Schlussfolgerungen und politische Empfehlungen
Die Studie macht deutlich, dass trans und nicht-binäre Sexarbeiter*innen in Kanada tiefgreifenden strukturellen Ungleichheiten und Gewaltformen ausgesetzt sind, die durch das aktuelle Rechtssystem nicht ausreichend adressiert werden. Vielmehr tragen gesetzliche Regelungen wie PCEPA aktiv zur Gefährdung dieser Gruppen bei.
Empfohlen wird:
Abschaffung von PCEPA: Die Entkriminalisierung von Sexarbeit – wie etwa in Neuseeland – wird als praktikable und sicherheitsfördernde Alternative genannt.
Schaffung nicht-polizeilicher Unterstützungsangebote: Viele Betroffene benötigen Zugang zu Hilfeleistungen, die nicht mit Justiz oder Polizei verknüpft sind.
Intersektionale Schutzmaßnahmen: Politiken und Dienste sollten besonders auf die Bedürfnisse von trans, nicht-binären, rassifizierten und indigenen Menschen abgestimmt sein.
Stärkung community-basierter Angebote: Peer-geführte, sexarbeitsfreundliche Initiativen sollten gestärkt und gefördert werden.
Der Volltext der Studie (englisch) findet sich hier.