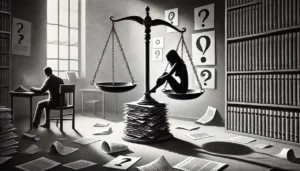Die Studie „Decriminalizing Indoor Prostitution: Implications for Sexual Violence and Public Health“ von Scott Cunningham und Manisha Shah untersucht die Auswirkungen der Entkriminalisierung von Indoor-Sexarbeit in Rhode Island auf die öffentliche Gesundheit und Kriminalität, insbesondere auf gemeldete Vergewaltigungen und die Verbreitung von sexuell übertragbaren Infektionen (STIs). Die Autoren nutzen dabei ein natürliches Experiment: Infolge einer unerwarteten gerichtlichen Entscheidung im Jahr 2003 wurde Indoor-Prostitution in Rhode Island für etwa sechs Jahre de facto entkriminalisiert, bevor sie 2009 wieder kriminalisiert wurde.
Hintergrund und Motivation der Studie
Weltweit ist Sexarbeit in den meisten Ländern, einschließlich der USA, verboten. Die gesetzlichen Regelungen ändern sich selten, was es schwierig macht, die tatsächlichen Auswirkungen einer Entkriminalisierung empirisch zu untersuchen. Die Autoren argumentieren, dass moralische Bedenken, aber auch Sorgen um die öffentliche Gesundheit und das Risiko von Gewalt gegen Sexarbeiterinnen die Hauptgründe für die Kriminalisierung sind. Die Indoor-Sexarbeit hat in den letzten Jahren stark zugenommen und macht mittlerweile bis zu 85% aller Sexarbeit in den USA aus.
Sexarbeit ist mit erheblichen Risiken verbunden: Sexarbeiterinnen berichten deutlich häufiger von Gonorrhoe-Infektionen als andere Frauen, und die Gefahr von Gewaltverbrechen wie Vergewaltigung und Mord ist in dieser Gruppe besonders hoch. Dennoch ist unklar, wie sich eine Entkriminalisierung tatsächlich auf diese Risiken auswirkt, da bisherige Studien meist auf kleinen, nicht-repräsentativen Stichproben beruhen und keine kausalen Zusammenhänge belegen können.
Das natürliche Experiment in Rhode Island
Im Jahr 2003 entdeckte ein Bezirksrichter in Rhode Island, dass eine Gesetzesänderung von 1980 unbeabsichtigt einen rechtlichen Graubereich geschaffen hatte: Während Straßenprostitution weiterhin verboten blieb, war Indoor-Prostitution (z. B. in Massagesalons) plötzlich legal. Diese Situation blieb bis 2009 bestehen, als das Gesetz erneut geändert wurde. Die Autoren betonen, dass diese Entkriminalisierung weder geplant noch öffentlich bekannt war, sondern auf einer technischen Gesetzeslücke beruhte. Erst durch die gerichtliche Entscheidung wurde die neue Rechtslage praktisch relevant und führte zu einem Rückgang der Strafverfolgung von Indoor-Sexarbeit.
Methodik
Die Autoren nutzen verschiedene Datenquellen, um die Auswirkungen der Entkriminalisierung zu analysieren:
Polizeiliche Kriminalstatistiken zu gemeldeten Vergewaltigungen
Gesundheitsdaten zur Verbreitung von Gonorrhoe bei Frauen
Daten zum Umfang und zur Preisgestaltung des Indoor-Sexmarkts (z. B. Online-Anzeigen)
Vergleichsdaten aus anderen Bundesstaaten ohne Gesetzesänderung
Durch die Kombination dieser Daten mit ökonometrischen Methoden können die Autoren den kausalen Effekt der Entkriminalisierung isolieren.
Zentrale Ergebnisse
Ausweitung des Indoor-Sexmarkts
Nach der Entkriminalisierung stieg die Zahl der Indoor-Sexarbeiterinnen und die Zahl der Online-Anzeigen deutlich an.
Die Preise pro Transaktion sanken, was auf einen Angebotsanstieg hindeutet.
Die Zahl der Festnahmen im Zusammenhang mit Indoor-Sexarbeit ging stark zurück.
Rückgang gemeldeter Vergewaltigungen
Die Zahl der gemeldeten Vergewaltigungen in Rhode Island sank nach der Entkriminalisierung um etwa 30% im Vergleich zu den Kontrollstaaten.
Die Autoren führen diesen Rückgang darauf zurück, dass Sexarbeit unter legalen Bedingungen sicherer wird (z. B. mehr Investitionen in Sicherheit, bessere Zusammenarbeit mit der Polizei) und sich das Risiko von Gewaltverbrechen gegen Frauen insgesamt verringert.
Bemerkenswert ist, dass der Rückgang nicht nur Sexarbeiterinnen, sondern auch die allgemeine weibliche Bevölkerung betraf. Die Autoren schätzen, dass ein erheblicher Anteil der Reduktion auf Nicht-Sexarbeiterinnen entfällt.
Rückgang von Gonorrhoe-Infektionen
Die Inzidenz von Gonorrhoe bei Frauen ging nach der Entkriminalisierung um über 40% zurück.
Auch hier betrifft der Rückgang sowohl Sexarbeiterinnen als auch die allgemeine weibliche Bevölkerung.
Die Autoren diskutieren, dass ein größerer und legaler Markt für Sexarbeit dazu führen kann, dass mehr „Low-Risk“-Sexarbeiterinnen tätig werden und sicherere Praktiken angewendet werden, was das Gesamtrisiko für die Bevölkerung senkt.
Theoretische Einordnung und Literaturüberblick
Die Autoren betonen, dass die theoretischen Effekte der Entkriminalisierung nicht eindeutig sind. Einerseits könnte ein größerer Sexmarkt zu mehr STIs führen, andererseits könnte der Eintritt von weniger risikobehafteten Sexarbeiterinnen das Infektionsrisiko für die Gesamtbevölkerung senken. Ähnlich ist es bei Gewalt: Während einige Theorien nahelegen, dass mehr Sexarbeit mit mehr Gewalt einhergeht, zeigen andere Studien, dass legale Rahmenbedingungen das Risiko für Gewaltverbrechen senken können.
Die Literatur weist darauf hin, dass Indoor-Sexarbeit im Vergleich zu Straßenprostitution mit weniger Ausbeutung, Gewalt und Gesundheitsrisiken verbunden ist. Dennoch gab es bisher kaum kausale Studien, die die Auswirkungen einer Entkriminalisierung empirisch belegen konnten. Die Arbeit von Cunningham und Shah schließt diese Lücke und liefert erstmals robuste Ergebnisse auf Basis eines natürlichen Experiments.
Implikationen für die Politik
Die Autoren argumentieren, dass die Ergebnisse ihrer Studie wichtige Implikationen für die Gesetzgebung und die Polizeiarbeit haben. Die Entkriminalisierung von Indoor-Sexarbeit führte nicht zu den befürchteten negativen Folgen wie einer Zunahme von Gewalt oder Infektionskrankheiten, sondern im Gegenteil zu deutlichen Verbesserungen in diesen Bereichen. Die Autoren weisen darauf hin, dass die Polizei in den USA große Ressourcen für die Verfolgung von Indoor-Sexarbeit aufwendet, obwohl diese Maßnahmen offenbar wenig zur öffentlichen Sicherheit beitragen.
Sie verweisen auch auf internationale Entwicklungen, etwa die Resolution von Amnesty International, die weltweit eine Entkriminalisierung von Sexarbeit fordert. Die Ergebnisse ihrer Studie liefern empirische Argumente, die diese Forderung stützen.
Meinung der Autoren zur Entkriminalisierung von Sexarbeit
Die Autoren sprechen sich nicht explizit normativ für eine Entkriminalisierung aus, sie betonen jedoch mehrfach die positiven Effekte, die sie empirisch nachweisen konnten. Sie heben hervor, dass die Entkriminalisierung von Indoor-Sexarbeit sowohl die öffentliche Gesundheit verbessert als auch schwere Gewaltverbrechen gegen Frauen reduziert. Sie sehen darin einen starken Hinweis darauf, dass die gängige Politik der Kriminalisierung nicht die gewünschten Effekte erzielt und stattdessen möglicherweise kontraproduktiv ist.
Die Autoren argumentieren, dass eine differenzierte Regulierung – insbesondere die Entkriminalisierung von Indoor-Sexarbeit – ein vielversprechender Ansatz sein könnte, um die negativen Begleiterscheinungen des Sexmarkts zu minimieren. Sie betonen, dass ihre Ergebnisse nicht nur für Sexarbeiterinnen, sondern für die gesamte weibliche Bevölkerung von Bedeutung sind, da die beobachteten Verbesserungen auf Bevölkerungsebene messbar sind.
Kritische Reflexion und Grenzen der Studie
Die Autoren sind sich der Limitationen ihrer Studie bewusst. Sie weisen darauf hin, dass ihre Ergebnisse auf den spezifischen Kontext von Rhode Island beschränkt sind und nicht ohne Weiteres auf andere Länder oder Regionen übertragbar sein müssen. Zudem können sie nicht alle potenziellen Nebeneffekte der Entkriminalisierung erfassen, etwa Auswirkungen auf Menschenhandel oder andere Formen der Ausbeutung. Dennoch sehen sie ihre Arbeit als wichtigen Beitrag zur evidenzbasierten Debatte um die Regulierung von Sexarbeit.
Fazit
Die Studie von Cunningham und Shah liefert erstmals kausale Evidenz dafür, dass die Entkriminalisierung von Indoor-Sexarbeit zu einem Rückgang schwerer Gewaltverbrechen gegen Frauen und einer Verbesserung der öffentlichen Gesundheit führt. Die Autoren plädieren für eine sachliche, empirisch fundierte Debatte über die Regulierung von Sexarbeit und sehen in der Entkriminalisierung von Indoor-Sexarbeit eine vielversprechende Alternative zur bisherigen Kriminalisierungspolitik.
Der Volltext der Studie (englisch) findet sich hier.