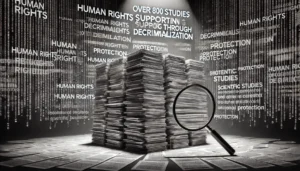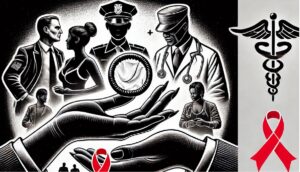Die schwedische Gesetzgebung zur Kriminalisierung des Kaufs sexueller Dienstleistungen, die 1999 eingeführt wurde, zielte darauf ab, die Nachfrage nach Prostitution zu verringern und Menschenhandel zu bekämpfen. Der schwedische Ansatz basierte auf der Idee, dass Prostitution eine Form von Gewalt gegen Frauen darstellt und dass die Bestrafung der Käufer, nicht jedoch der Verkäufer, die soziale Akzeptanz verringern und den Markt für Prostitution austrocknen würde.
Hintergrund und Zielsetzung
Die schwedische Regierung wollte mit dem Gesetz die Anzahl der Sexkäufer reduzieren, die Anzahl der Menschen in der Prostitution verringern und Menschenhandel sowie die Anwesenheit von Migranten in der Sexarbeit unterbinden. Man hoffte, dass die Angst vor Verhaftung und sozialer Ächtung Männer dazu bringen würde, auf den Kauf sexueller Dienstleistungen zu verzichten, und dass Frauen aus der Prostitution aussteigen würden.
Historischer Kontext und gesellschaftliche Debatte
Das Gesetz entstand in einem gesellschaftspolitischen Klima, in dem feministische Bewegungen und Menschenrechtsorganisationen die Rechte von Frauen und die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen in den Vordergrund stellten. Die schwedische Gesellschaft war stark von der Idee geprägt, soziale Gerechtigkeit und Gleichstellung der Geschlechter zu fördern.
Methodik und Umsetzung
Die Gesetzgebung fokussierte sich auf die Bestrafung der Käufer sexueller Dienstleistungen, während die Anbieterinnen als Opfer von Gewalt und Ausbeutung betrachtet wurden. Sozialdienste und Programme zur Unterstützung von Ausstiegswilligen wurden eingeführt, jedoch nur unzureichend finanziert und umgesetzt. Polizei und Sozialdienste sollten zusammenarbeiten, um Sexarbeiterinnen aus der Prostitution zu „retten“ und Alternativen zu bieten.
Ergebnisse und Kritik
Die Studie zeigt jedoch, dass die schwedische Regierung ihre Ziele nicht erreicht hat. Es gibt keine verlässlichen Beweise dafür, dass die Anzahl der Sexkäufer oder Sexarbeiterinnen gesunken ist oder dass der Menschenhandel reduziert wurde. Stattdessen sind negative Konsequenzen für die betroffenen Sexarbeiterinnen entstanden, wie ein erhöhtes Risiko für Gewalt und soziale Ausgrenzung.
Unklare Datenlage
-
Fehlende Evidenz:
-
Die schwedische Regierung behauptet, dass die Straßenprostitution um 50 % zurückgegangen sei. Es gibt jedoch keine Beweise dafür, dass die Menschen aus der Prostitution ausgestiegen sind, anstatt in verstecktere oder digitale Plattformen zu wechseln.
-
Es existieren keine verlässlichen Daten darüber, ob die Anzahl der Sexkäufer tatsächlich abgenommen hat, da viele Männer ins Ausland ausweichen oder Dienstleistungen online in Anspruch nehmen.
-
-
Mangel an wissenschaftlicher Methodik:
-
Die Regierung stützt ihre Behauptungen auf Umfragen und Berichte, die methodische Schwächen aufweisen und keine kausalen Zusammenhänge belegen können.
-
Erhöhtes Risiko für Sexarbeiterinnen
-
Verlagerung in unsichere Umgebungen:
-
Da Kunden Angst vor Verhaftung haben, verlagert sich die Prostitution in schwerer kontrollierbare und gefährlichere Umgebungen.
-
Sexarbeiterinnen sind gezwungen, riskantere Kunden anzunehmen und schneller Deals abzuschließen, um nicht von der Polizei entdeckt zu werden.
-
-
Gewalt und Ausbeutung:
-
Berichte zeigen, dass Sexarbeiterinnen einem erhöhten Risiko für physische und sexuelle Gewalt ausgesetzt sind.
-
Migrantinnen ohne legalen Aufenthaltsstatus können sich nicht an die Polizei wenden und sind besonders gefährdet.
-
Stigmatisierung und soziale Ausgrenzung
-
Gesellschaftliche Ächtung:
-
Das Gesetz verstärkt die soziale Stigmatisierung von Sexarbeiterinnen und erschwert den Zugang zu Gesundheitsdiensten und rechtlichem Schutz.
-
-
Diskriminierung und Isolation:
-
Sexarbeiterinnen werden als Opfer dargestellt, deren Handlungsfähigkeit ignoriert wird. Dies führt zu weiterer Marginalisierung und Diskriminierung.
-
Fehlende Unterstützung für den Ausstieg
-
Unzureichende soziale Unterstützung:
-
Die schwedische Regierung hat es versäumt, ausreichende soziale und wirtschaftliche Unterstützung für diejenigen bereitzustellen, die aus der Prostitution aussteigen möchten.
-
-
Fehlende Einbindung von Sexarbeiterinnen:
-
Die Gesetzgebung wurde ohne Konsultation der Betroffenen entwickelt, was die Bedürfnisse und Perspektiven der Sexarbeiterinnen ignoriert.
-
Vergleich mit anderen Ländern
-
Norwegen und Island:
-
Beide Länder haben ähnliche Gesetze eingeführt und berichten von ähnlichen negativen Auswirkungen, darunter erhöhte Gewalt und soziale Ausgrenzung.
-
-
Kanada:
-
In Kanada wurden Gesetze, die die Sicherheit von Sexarbeiterinnen einschränken, als verfassungswidrig erklärt. Dies unterstreicht die Notwendigkeit eines menschenrechtsbasierten Ansatzes.
-
Langfristige Auswirkungen
-
Verlagerung in den Untergrund: Sexarbeiterinnen weichen auf weniger sichtbare und unsicherere Orte aus.
-
Abhängigkeit von Zuhältern: Aufgrund der Isolation und des Schutzbedarfs sind viele gezwungen, sich auf Dritte zu verlassen.
-
Einschränkung der Gesundheitsversorgung: Angst vor Verhaftung führt dazu, dass Sexarbeiterinnen seltener Gesundheitsdienste in Anspruch nehmen.
-
Schwächung von Vertrauen und Kooperation: Sexarbeiterinnen vermeiden den Kontakt zu Behörden und NGOs, was die Identifizierung von Menschenhandel erschwert.
Empfehlungen der Studie
-
Aufhebung des Gesetzes:
-
Das schwedische Modell hat seine Ziele verfehlt und sollte abgeschafft werden.
-
-
Rechtebasierter Ansatz:
-
Einführung von Arbeitsrechten für Sexarbeiterinnen und Bereitstellung von sozialen und gesundheitlichen Diensten.
-
-
Unabhängige Forschung:
-
Eine unabhängige, wissenschaftlich fundierte Untersuchung der Auswirkungen von Prostitution und Menschenhandel.
-
-
Einbeziehung von Sexarbeiterinnen:
-
Ein partizipativer Ansatz, der die Stimmen und Bedürfnisse der Betroffenen berücksichtigt.
-
-
Internationale Kooperation:
-
Austausch bewährter Praktiken und Erfahrungen mit anderen Ländern, die alternative Ansätze verfolgen.
-
Fazit
Das schwedische Modell zur Kriminalisierung von Sexkäufern hat seine Ziele nicht erreicht und die Situation für Sexarbeiterinnen verschlechtert. Die Studie plädiert für einen menschenrechtsbasierten Ansatz, der die Rechte und die Sicherheit der Betroffenen in den Vordergrund stellt und auf evidenzbasierte Forschung setzt, anstatt auf ideologische Annahmen. Ein umfassender Ansatz, der Prävention, soziale Unterstützung und die rechtliche Anerkennung von Sexarbeit beinhaltet, wird als effektiver angesehen, um die Situation von Sexarbeiterinnen zu verbessern und Menschenhandel wirksam zu bekämpfen.
Der Volltext der Studie (englisch) findet sich hier.