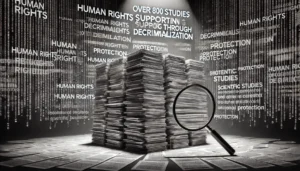Die Studie „Mobilizing shame and disgust: abolitionist affective frames in Austrian and German anti-sex-work movements“ von Birgit Sauer untersucht die Strategien und affektiven Rahmen, die abolitionistische Bewegungen in Österreich und Deutschland seit 2014 nutzen, um gegen Sexarbeit zu mobilisieren. Der Fokus liegt darauf, wie diese Bewegungen Gefühle wie Scham und Ekel mobilisieren, um soziale und politische Veränderungen herbeizuführen, und welche Auswirkungen dies auf die Gesellschaft und insbesondere auf das Verständnis von Sexualität und Geschlechterverhältnissen hat.
Kontext und Einleitung
In Österreich und Deutschland wurden in den letzten Jahrzehnten Gesetze eingeführt, die Prostitution legalisieren und regulieren. In Österreich wurde 2012 Prostitution als Arbeit anerkannt, wodurch sie nicht mehr als unmoralisch gilt. In Deutschland erfolgte eine ähnliche Entwicklung mit dem Prostitutionsgesetz von 2002, das es Sexarbeiter*innen ermöglicht, rechtliche Ansprüche auf Löhne zu erheben und Zugang zu sozialen Sicherungssystemen zu erhalten. Trotz dieser Fortschritte regten sich in beiden Ländern Widerstände, vor allem aus konservativen und abolitionistischen Kreisen. Diese Bewegungen argumentieren, dass Prostitution Gewalt gegen Frauen darstellt und rufen dazu auf, Freier strafrechtlich zu verfolgen – eine Strategie, die auch als „Schwedisches Modell“ bekannt ist.
Die Autorin betrachtet diese Entwicklungen aus einer affektiven Perspektive und analysiert, wie Emotionen und Gefühle bewusst von abolitionistischen Bewegungen eingesetzt werden, um politische Ziele zu erreichen. Ziel der Studie ist es, aufzuzeigen, wie diese Strategien dazu beitragen, eine restriktive, heteronormative Sexualität zu fördern und bestimmte Gruppen aus der gesellschaftlichen Gemeinschaft auszuschließen.
Theoretischer Hintergrund
Die Studie greift auf Theorien über Emotionen und soziale Bewegungen zurück. Bis in die 1990er Jahre dominierten in der Forschung rationale Ansätze, die soziale Bewegungen als strategisch und vernunftbasiert beschrieben. Seitdem hat ein „emotional turn“ stattgefunden, der die Bedeutung von Emotionen wie Angst, Wut und Mitgefühl als zentrale Elemente sozialer Bewegungen anerkennt. Emotionen werden dabei als Ressource betrachtet, um Solidarität innerhalb einer Bewegung zu schaffen, Aufmerksamkeit zu erregen und gesellschaftliche Normen zu verändern.
Birgit Sauer erweitert diesen Ansatz um den Begriff der „affektiven Gouvernementalität“, der auf Michel Foucaults Konzept der Regierungsrationalität basiert. Affektive Gouvernementalität beschreibt, wie Gefühle genutzt werden, um Individuen zu beeinflussen, gesellschaftliche Normen zu formen und Macht auszuüben. Insbesondere in Fragen der Sexualität spielen Affekte eine entscheidende Rolle, um zu definieren, welche Formen von Sexualität akzeptabel sind und welche nicht.
Methodik
Die Studie basiert auf einer Analyse von Texten und Online-Kampagnen abolitionistischer Bewegungen in Österreich und Deutschland. Dazu zählen Websites, öffentliche Appelle und redaktionelle Beiträge von Organisationen wie dem „Verein feministischer Diskurs“ in Wien oder „Emma“ in Deutschland. Die Autorin verwendet eine affektive Rahmenanalyse, um zu untersuchen, wie Probleme und Lösungen dargestellt und mit Gefühlen verknüpft werden. Besonderes Augenmerk liegt auf der Nutzung von Scham und Ekel als Mittel der Mobilisierung.
Ergebnisse
Mobilisierung durch affektive Rahmen
Abolitionistische Bewegungen nutzen Affekte, um öffentliche Aufmerksamkeit zu gewinnen und ihre politischen Ziele durchzusetzen. Sechs zentrale Strategien wurden identifiziert:
Schuldzuweisung an politische Gegner: Abolitionistische Akteure beschuldigen politische Entscheidungsträger und feministische Bewegungen, die Prostitution legalisieren, Gewalt gegen Frauen zu fördern. Deutschland wird dabei häufig als das „Bordell Europas“ bezeichnet, während Frankreich und Schweden als positive Beispiele hervorgehoben werden.
Authentifizierung durch persönliche Geschichten: Ehemalige Sexarbeiter*innen berichten von ihren Erfahrungen mit Gewalt und Traumatisierung, um Empathie zu erzeugen und das Publikum emotional zu berühren. Diese Berichte dienen dazu, Prostitution als inhärent gewalttätig darzustellen.
Weibliche Solidarität: Die Bewegungen appellieren an das Mitgefühl von Frauen, indem sie Sexarbeiter*innen als Opfer von männlicher Gewalt darstellen. Bilder von „Sklaverei“ und „Zwangsarbeit“ sollen Empörung und Handlungsdruck erzeugen.
Mobilisierung des schlechten Gewissens: Feministinnen und Politikerinnen werden aufgefordert, Prostitution als Widerspruch zur Geschlechtergleichheit zu betrachten. Diese Strategie nutzt bestehende Gleichheitsnormen, um Scham und Schuldgefühle zu erzeugen.
Ansprechen aller Frauen: Die Kampagnen betonen, dass Prostitution alle Frauen betrifft, da Freier aus allen gesellschaftlichen Schichten kommen und Ehen sowie Familien zerstören können. Damit sollen auch Frauen, die nicht direkt betroffen sind, emotional angesprochen werden.
Kritik an der Kommodifizierung: Prostitution wird als Ausbeutung des weiblichen Körpers und als Symptom eines entfesselten Kapitalismus dargestellt. Diese Kritik richtet sich vor allem an linke politische Kreise.
Veränderung der Affektkultur
Die abolitionistischen Bewegungen versuchen, die gesellschaftliche Gefühlskultur in Bezug auf Prostitution zu verändern. Während Sexarbeit lange Zeit mit Scham und Stigmatisierung der Sexarbeiter*innen verbunden war, zielen die Kampagnen darauf ab, Ekel und Abscheu auf die Freier zu lenken. Diese Umkehrung soll dazu beitragen, Prostitution als unvereinbar mit gesellschaftlichen Normen darzustellen und Freier aus der Gemeinschaft auszuschließen.
Regierung durch Sexualität
Die Studie zeigt, dass die abolitionistischen Bewegungen nicht nur Prostitution bekämpfen, sondern auch ein bestimmtes Verständnis von Sexualität propagieren. Sexualität wird als natürlich und rein dargestellt, sofern sie in liebevollen, monogamen Beziehungen stattfindet. Kommerzialisierte oder von gesellschaftlichen Normen abweichende Sexualität wird hingegen als gefährlich und unnatürlich bezeichnet. Diese normative Sichtweise trägt dazu bei, bestehende patriarchale und heteronormative Strukturen zu reproduzieren.
Schlussfolgerungen
Die abolitionistischen Bewegungen in Österreich und Deutschland nutzen Affekte wie Scham und Ekel als machtvolle Mittel, um gesellschaftliche Normen zu beeinflussen und politische Veränderungen herbeizuführen. Gleichzeitig birgt diese Strategie jedoch die Gefahr, patriarchale und heteronormative Strukturen zu festigen, anstatt sie zu hinterfragen. Die Studie hebt hervor, dass diese Bewegungen zwar für Geschlechtergerechtigkeit eintreten, dabei jedoch die Agency von Sexarbeiter*innen negieren und eine restriktive Sexualmoral propagieren. Insgesamt leistet die Studie einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der Rolle von Affekten in sozialen Bewegungen und der affektiven Dimension von Macht.
Der Volltext der Studie (englisch) findet sich hier.