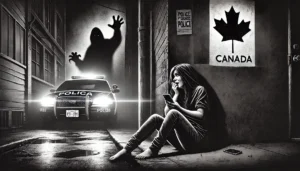Die Studie „Sex Work Criminalization Is Barking Up the Wrong Tree“ von Ine Vanwesenbeeck (2017) liefert eine umfassende, kritische Analyse der globalen Entwicklungen im Bereich der Prostitutionspolitik, insbesondere der zunehmenden Repression und Kriminalisierung von Sexarbeit. Die Autorin argumentiert anhand zahlreicher empirischer Belege, dass kriminalisierende oder moralisch motivierte Politiken nicht nur ineffektiv sind, sondern grundlegende Menschenrechte und die öffentliche Gesundheit gefährden. Die Studie positioniert sich klar zugunsten der Entkriminalisierung von Sexarbeit und deckt die destruktiven Folgen repressiver Ansätze auf individueller sowie struktureller Ebene auf.
Hintergrund: Kriminalisierende Regime und ihre Logik
Weltweit dominiert weiterhin die Kriminalisierung als staatliche Antwort auf kommerzielle Sexualität. Unter solche Regime fallen Gesetze, die entweder das Anbieten, Organisieren oder den Kauf sexueller Dienstleistungen kriminalisieren. Die zugrunde liegende Ideologie ist meist abolitionistischer Natur: Kommerzielle Sexualität wird als grundsätzlich unmoralisch und ausbeuterisch angesehen, ihre Kriminalisierung gilt entsprechend als Weg zur vollständigen Abschaffung. Allerdings variieren diese Regime deutlich in ihrer Intensität, also der Strenge bei Überwachung und Strafverfolgung.
Demgegenüber steht die Entkriminalisierung, die weltweit nur in sehr wenigen Ländern praktiziert wird – beispielhaft ist hier Neuseeland zu nennen, das seit 2003 Sexarbeit als normale Erwerbsarbeit behandelt (innerhalb bestimmter rechtlicher Rahmen). Dieser Ansatz erkennt Sexarbeit als legitime Erwerbstätigkeit an und zielt darauf ab, die Rechte der arbeitenden Personen zu stärken sowie Stigma zu reduzieren.
Zwischen diesen Polen liegt die Legalisierung, die zwar eine rechtliche Regulierung der Sexarbeit vorsieht, aber auf Basis umfangreicher Vorschriften erfolgt – etwa zu Alter, Aufenthaltsstatus, Registrierung oder medizinischen Untersuchungen. So wird Sexarbeit zwar formal anerkannt, steht aber unter starker Kontrolle und Einschränkung. Länder wie die Niederlande und Deutschland werden meist mit diesem Modell in Verbindung gebracht. Doch wie Vanwesenbeeck betont, ist auch diese Form in der Praxis zunehmend restriktiv ausgelegt, was faktisch zu einer selektiven Kriminalisierung führt.
Die Zunahme von „Neo-Abolitionismus“
Zentraler Fokus der Studie ist die wachsende Verbreitung eines sogenannten „Neo-Abolitionismus“. Dieses Konzept beschreibt eine moderne Form des Abolitionismus, die insbesondere auf zwei Pfeilern ruht: Dem Anti-Trafficking-Diskurs (Menschenhandel) und der Kriminalisierung der Sexkäufer (Nordisches Modell).
Erstens beobachtet Vanwesenbeeck eine dramatische Zunahme des Antitrafficking-Diskurses in politischen Debatten über Sexarbeit. Besonders die USA trieben seit den 2000er-Jahren diesen Kurs voran, unter anderem durch internationale Abkommen wie das UN-Trafficking-Protokoll. Dieser Diskurs geht oft so weit, dass freiwillige Sexarbeit faktisch mit Menschenhandel gleichgesetzt wird. Die Grenze zwischen Arbeitsmigration und Zwangsarbeit ist häufig unklar definiert, was zu einer Übererfassung und problematischen Statistiken führt – etwa in den Niederlanden, wo bereits der bloße Verdacht genügt, um Fälle als „mögliche Opfer von Menschenhandel“ zu zählen.
Zweitens hat eine wachsende Zahl von Ländern – insbesondere in Europa und Nordamerika – die Kriminalisierung des Sexkaufs eingeführt. Dies basiert auf dem schwedischen Modell (seit 1998), welches behauptet, durch „Nachfragereduktion“ die Sexarbeit abschaffen zu können. Diese Politik wird oft mit feministischen Argumenten legitimiert, betont aber, dass die Sexarbeitenden selbst nicht kriminalisiert werden sollen. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass auch sie von Polizei, Verwaltung und Gesellschaft weiterhin verfolgt und benachteiligt werden, etwa durch Kontrollen, Zwangsberatung oder durch die Einschränkung ihrer Lebens- und Arbeitsverhältnisse.
Folgen repressiver Politiken
Ein zentraler Befund der Studie ist: Repression und Kriminalisierung machen die Bedingungen in der Sexarbeit nicht sicherer, sondern gefährlicher. Vanwesenbeeck verwendet dafür den Begriff der „Waterbed Politics“, um auf die Verdrängungseffekte hinzuweisen. Analog zum Prinzip einer Wasserbett-Matratze werden Sexarbeiter*innen durch Druck an einer Stelle lediglich an eine andere verdrängt – meist in prekärere, unsichtbare und weniger regulierte Arbeitsbereiche.
Auswirkungen auf Gesundheit und Sicherheit
Besonders deutlich wird dies im Bereich Gesundheit (insbesondere HIV/STI-Prävention) und Gewaltprävention. Die Studie verweist auf systematische Reviews (z.B. Shannon et al. 2015, deutsche Zusammenfassung hier), die belegen, dass Entkriminalisierung die wirksamste Maßnahme zur Senkung des HIV-Risikos unter Sexarbeiter*innen wäre. Modellierungen zeigten, dass 33–46% der HIV-Neuinfektionen in den nächsten zehn Jahren vermieden werden könnten, wenn Entkriminalisierung mit Community-Empowerment kombiniert würde. Indikatoren hierfür sind: weniger Polizeigewalt, sicherere Arbeitsplätze, besserer Zugang zu Kondomen und Gesundheitsdiensten.
Zugleich ist das Risiko physischer oder sexueller Gewalt in kriminalisierten Kontexten bis zu siebenmal erhöht, vor allem wenn Sexarbeiterinnen bereits Erfahrungen mit Verhaftung oder Inhaftierung gemacht haben. Besonders gefährdet sind Straßenarbeiter*innen , migrantische, transgeschlechtliche oder drogenkonsumierende Arbeiter*innen.
Ein zentrales Problem ist, dass Stigma und Illegalität den Zugang zu Rechtsstaatlichkeit versperren: Viele Sexarbeiter*innen trauen sich etwa nicht, Übergriffe zur Anzeige zu bringen, aus Angst, selbst bestraft zu werden. In vielen Ländern gelten Polizisten als direkte Bedrohung – durch Gewalt, Erpressung oder Vergewaltigung –, und nicht als Quelle von Schutz.
Problematische Rolle der „Rettungsindustrie“
Ein weiteres Thema ist die sogenannte Rettungsindustrie („rescue industry“), also staatliche oder zivilgesellschaftliche Initiativen, die unter dem Vorwand von Anti-Menschenhandel Einsätze und Razzien durchführen. Vanwesenbeeck zitiert Beispiele, bei denen diese „Rettungseinsätze“ die betroffenen Frauen mehr geschädigt als geschützt haben – durch Entwurzelung, Verhaftung, Outing, Verlust von Eigentum oder gar Abschiebung. Vor allem migrantische Sexarbeiter*innen sind demnach besonders verletzlich. Sie werden nicht selten unter Generalverdacht gestellt, selbst wenn sie freiwillig arbeiten. In solchen Fällen verweigert man ihnen das Recht auf Aufenthalt, Arbeit und oft sogar auf Selbstbestimmung.
Negative Auswirkungen auf Arbeitsbedingungen
Auch innerhalb der Arbeitswelt hat Kriminalisierung schwerwiegende Folgen: Sexarbeiterinnen sehen sich, oft aus Angst vor Strafverfolgung, gezwungen, unsicherere, isolierte oder mobile Arbeitssituationen zu wählen. Kontakte zu Kolleginnen, gemeinsames Arbeiten oder gemeinsame Sicherheitsmaßnahmen werden erschwert oder unter Strafe gestellt (etwa mit Berufung auf vermeintlichen Menschenhandel). Infolge repressiver Regulierungen meiden viele Betroffene soziale und behördliche Strukturen völlig, was zu noch größerer sozialer Marginalisierung führt.
Kriminalisierung: Weder Schutz noch Lösung
Vanwesenbeeck kommt zu einer fundamentalen Kritik: Die Kriminalisierung von Prostitution verfehlt ihr Ziel vollständig. Weder schützt sie tatsächlich die Menschen, die Opfer von Ausbeutung sind, noch verbessert sie die strukturellen Ursachen (z. B. Armut, Geschlechterungleichheit), aus denen heraus Menschen in die Sexarbeit einsteigen. Vielmehr fördert sie Märkte für kriminelle Zwischenhändler und Konstruktionen der Abhängigkeit. Letztlich verschärft sie genau die Probleme, die sie zu lösen vorgibt: Verelendung, Gewalt und Ausgrenzung.
Auch im Kampf gegen Menschenhandel ist Kriminalisierung hinderlich. Die Regelungen behandeln Opfer oftmals schlecht, etwa durch die Forderung, die Sexarbeit aufzugeben, durch fehlenden Zeugenschutz oder durch sofortige Abschiebung. Undurchsichtige Definitionen des Begriffs Menschenhandel führen zudem dazu, dass selbst freiwillige Kooperationen und Unterstützungsnetzwerke kriminalisiert werden.
Schlussfolgerung
Vanwesenbeeck plädiert eindringlich dafür, Sexarbeit als legitime Form sexueller und ökonomischer Praxis zu erkennen – sofern sie freiwillig, nicht missbräuchlich und unter Kontrolle der arbeitenden Personen geschieht. Repressive Politiken machen solche Bedingungen weniger wahrscheinlich und schaden sowohl den Sexarbeiter*innen als auch tatsächlichen Opfern von Gewalt und Ausbeutung.
Die Autorin fordert ein radikales Umdenken: Nicht das Sexualverhalten sei kriminell, sondern die Umstände, die Zwang und Missbrauch ermöglichen. Ein Fokus auf Menschenrechte, Empowerment und soziale Gerechtigkeit sei notwendig, um den realen Problemen zu begegnen.
Vanwesenbeeck bezeichnet die Kriminalisierung somit als Irrweg, der vom eigentlichen Problem – strukturelle Ungleichheit und Armut – ablenkt und diese sogar verstärkt. Die Justiz ist dafür das falsche Instrument. Der anhaltende moralische und politische Druck, der Sexarbeit stigmatisiert und reglementiert, verdiene eine kritische Überprüfung – auch, um selbsternannte „feministische“ Lösungen auf ihre tatsächlichen Effekte hin zu beleuchten.
Der Volltext der Studie (englisch) findet sich hier.